Bei dem „Global Board Meeting“ des Volkswagen-Konzerns am 16.01.2020 mahnte Konzernchef Herbert Diess an, dass es an der Zeit wäre für Veränderung. „Die Welt ist in Bewegung“, Volkswagen stehe mitten im Sturm der beiden größten Transformationsprozesse und müsse reagieren. Der Klimawandel und der damit verbundene Innovationsdruck zum emissionsfreien Fahren, als auch die Digitalisierung, die das Produkt Automobil grundlegend verändert, müssen angegangen werden.
Diess gibt zu Beginn seiner Rede zu verstehen, dass der „Konzern nicht immer die besten Voraussetzungen hat, um schnell und konsequent genug auf diese Entwicklungen zu reagieren.“ Gemessen daran habe sich der Konzern bisher allerdings nicht schlecht geschlagen. Doch es gilt zu bedenken: „Der Sturm geht jetzt erst los.“ wie der CEO des VW-Konzerns mehr als eindeutig zu verstehen gibt. Man habe aber bereits die passenden Lösungen parat.
VW ID.3 als Stützpfeiler beim Erreichen der CO2-Flottenwerte
Eine davon sei, dass der ID.3 auf die Straße muss. Dazu müssen Herausforderungen im Anlauf bewältigt werden: die Challenge ist die Software- und Elektronik-Komplexität. Zur Software-Problematik gab ein VW-Sprecher zuletzt zu verstehen: “Der Zeitplan bleibt bestehen: Die Markteinführung ist für Sommer 2020 geplant.” Der VW-Sprecher sagte, das Unternehmen wolle noch in diesem Jahr rund 100.000 Elektroautos in seinem Werk in Zwickau bauen. Eine vernünftige Basis, um den CO2-Flottenwerten zu begegnen.
Diess lässt aber auch erkennen, dass nicht die gesamten CO2-Flottenwerte vom ID.3 geschultert werden können: „Dazu kommt, dass wir für die Einhaltung der Grenzwerte auch Seat Mii, VW Up!, e-Golf, e-tron und Taycan mit Batterien versorgen, bauen und in Kundenhände bringen müssen.“ Aus seiner Sicht seien diese Herausforderungen in der Summe die vielleicht schwierigste Aufgabe, die Volkswagen je vor der Brust hatte.
Umsetzung der E-Strategie ohne Profitabilitätsverluste
Es ist mittlerweile klar, VWs Zukunft sieht man in China und E-Mobilität hat hohe Priorität bei VW. Wie hoch, dass sieht man an den VW-Auslieferungspläne für China: 2020 bereits 300.000 E-Autos; ab 2025 eine Mio. Fahrzeuge pro Jahr. Wobei man diese Prognose bereits im Dezember 2019 um weitere zwei Jahre nach vorne geholt hat. Für China alleine wird man vier Milliarden Euro investieren. Bis 2024 sollen insgesamt 11 Mrd. Euro investiert werden. Weltweit.
Diese Strategie muss umgesetzt werden, konsequent. Ohne allerdings Profitabilitätsverluste in Kauf zu nehmen. „Die Margen im Jahr 2020 müssen mindestens halten. Wir haben das Potenzial dazu, wenn wir den Ernst der Lage wirklich zum Anlass nehmen, um die Potenziale dieses Konzerns voll auszuschöpfen und wo nötig auch heilige Kühe zu schlachten“, so der CEO des VW Konzerns zu diesem Thema.
Wichtiger Baustein hierfür ist der Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) – der Schlüssel für “Elektroautos für Alle”. Wirtschaftliche Produktion sei dabei oberstes Ziel. Bereits heute lässt sich festhalten, dass man effizienter und nachhaltiger in der Produktion vorankommt. Eine Preisparität zwischen Verbrenner und E-Auto sei allerdings erst mit der 2. Generation der MEB-Stromer zu erreichen.
„Wir werden die Synergien im Konzernverbund deutlich konsequenter nutzen und müssen die Komplexität noch deutlicher reduzieren. Dazu bilden wir die Synergiefamilien. Die Idee, bei der Modellentwicklung zwischen den Marken größtmögliche Synergien zu nutzen, ist nicht neu.“ – Herbert Diess, CEO VW-Konzern
Ein weiteres Beispiel für die Synergie im Konzern ist die Zusammenarbeit zwischen Audi und Porsche. Um langfristig Kosten zu senken, soll unter anderem diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden. Eine gemeinsame Fahrzeugarchitektur von Audi und Porsche ist hierbei der erste Schritt, um die Elektromobilität im eigenen Unternehmen voranzubringen, wobei sich diese wohl auf 2022 verzögert.
Reduktion auf das Wesentliche: Brennstoffzelle kaum Relevanz
Bereits in einem Beitrag von Mitte November 2019 hat VW aufgezeigt, wo nach aktuellem Stand die entscheidenden Vorteile des E-Antriebs gegenüber der Brennstoffzelle liegen. Und warum der Hersteller die Entscheidung, E-Mobilität konsequent voranzutreiben, für richtig hält. Dies unterstrich der VW-CEO in seiner Rede dadurch, dass er bekanntgab, dass die Brennstoffzelle und die Liquid Fuels auf Grundlevel weiterentwickelt werden.
„Sie sind auf einen absehbaren Zeithorizont von mindestens einem Jahrzehnt keine Alternative für PKW-Motoren. Wir brauchen die volle Konzentration auf den Durchbruch der Elektromobilität“, so Diess weiter. Die Entscheidung des Volkswagen Konzerns ist eindeutig: Als großer Volumenhersteller setzt er auf batteriebetriebene Elektroautos für eine breite Zielgruppe. Denn die Mobilitätswende allerdings muss sich – schon allein des Klimaschutzes und der Pariser Verträge willen – in großen Volumina vollziehen. Schon in wenigen Jahren will Volkswagen mehr als eine Million Elektro-Fahrzeuge jährlich verkaufen.
„Wir brauchen die gemeinsame Einsicht in die Radikalität des Wandels. In die Größe unserer Aufgabe. Und in die Kürze der Zeit.“ – Herbert Diess, CEO VW-Konzern
Quelle: Volkswagen AG – Rede von VW-Chef Herbert Diess auf dem Global Board Meeting am 16.1.2020




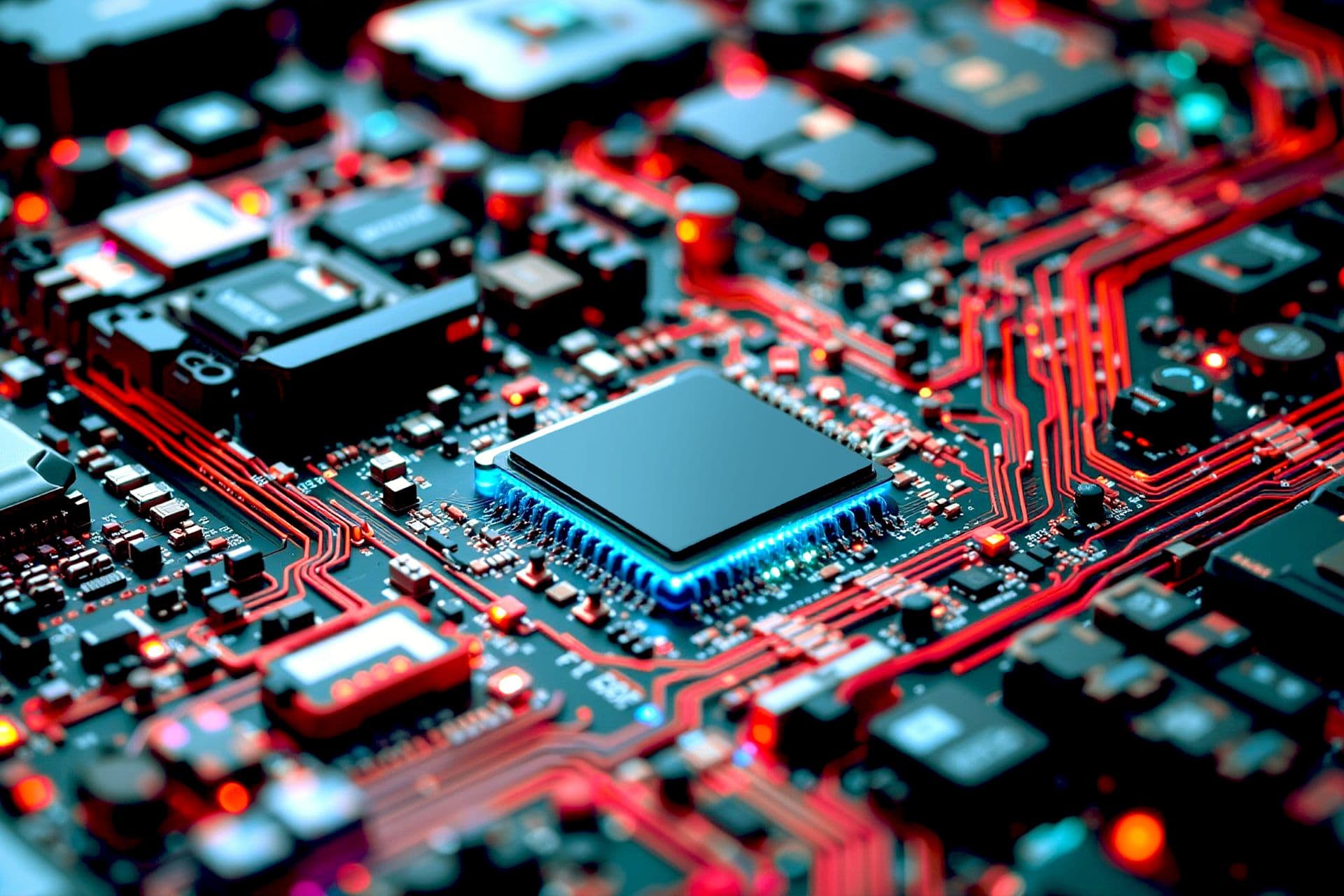



Kommentare (Wird geladen...)